 |
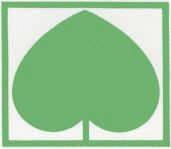 |
Egerländer Gmoi Wendlingen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Geschichte | Egerland
Das Egerland Die Egerländer in Wendlingen Wann, Warum und Wie kamen die Egerländer nach Baden-Württemberg, nach Wendlingen?
Das Egerland liegt im Nordwesten Böhmens. Es grenzt im Norden an Sachsen und im Westen an Bayern. Seine Grenzen sind nicht mit den Staats- oder Ländergrenzen identisch; von Landschaft und Sprache her gehören einige Landstriche im Westen und Norden dazu. Seinen Namen hat es von dem Fluss, der es durchfließt, der Eger. Sie entspringt im Fichtelgebirge und mündet in die Elbe.
Geographisch gesehen besteht das Egerland aus folgenden Gebieten:
der ehemals freien Reichsstadt Eger,
den Randzonen des westlichen Erzgebirges,
dem Falkenauer Becken,
dem Duppauer Gebirge,
dem Tepler Hochland mit dem Kaiserwald,
und dem nördlichen Böhmerwald.
Charakteristisch für diese Region im Nordwesten Böhmens ist einerseits die ländliche Kultur mit ihren einmaligen Bauformen, bemalten Möbeln, Trachten und Zeugnissen der Frömmigkeit. Andererseits hatten besonders die Kurorte Karlsbad, Marienbad und Franzensbad wesentlichen Einfluss auf das Kultur- und Wirtschaftsleben des Egerlandes. Vor allem Kunsthandwerk und Handel profitierten von den Badegästen aus aller Welt.
Die reichlich vorhandenen Bodenschätze begünstigten das Entstehen einer sich gut entwickelnden Industrie, ganz besonders einer weltbekannten Porzellanindustrie.
Weltweit bekannt sind Egerländer Musik und Karlsbader Oblaten. Aber auch die Egerer Reliefintarsien, Zinngießer-Arbeiten, Federvogel-Bilder oder Sprudelstein-Arbeiten wurden und werden in Kennerkreisen geschätzt, ebenso wie Musikinstrumente aus dem Egerland.
Das Egerland war über 900 Jahre lang von Deutschen bewohnt und von deren kulturellem Leben, ihren Sitten und Bräuchen geprägt. Nach der Volkszählung vom 17.5.1939 lebten im Egerland auf einer Fläche von 7466 km2 803.300 Bewohner. Seine deutsche Bevölkerung wurde zum größten Teil 1945/46 aus ihrer der angestammten Heimat vertrieben.
Oskar Storm, Neuhausen/Filder, Juni 2002; (ergänzt im Jänner 2003 )
Quelle: Ernst Bartl: „Egerland einst und jetzt“, Egerland-Verlag, Geislingen/Steige,1959
Faltblatt des Egerlandmuseums Marktredwitz, 1991.[zurück zum Inhaltsverzeichnis]
Wann, Warum und Wie kamen die Egerländer nach Baden-Württemberg, nach Wendlingen?
Wann kamen die Egerländer nach Baden-Württemberg, nach Wendlingen?
1945/46 wurden die Egerländer, wie alle Sudeten- und Ostdeutschen aus ihrer, seit über 1000 Jahren angestammten Heimat vertrieben.
Auf der Suche nach einer vorläufigen Bleibe und einer Arbeit kamen die Egerländer auch nach Baden- Württemberg. „Vorläufige Bleibe“ deshalb, da kein Mensch glauben konnte, dass es keine Rückkehr geben wird, dass eine derartige Unmenschlichkeit von Dauer sein würde. Alle Planungen waren auf eine baldige Rückkehr ausgerichtet. Keiner wollte glauben, dass mit der Zeit aus der vorläufigen Bleibe eine zweite Heimat werden sollte!
Warum kamen die Egerländer nach Baden-Württemberg, nach Wendlingen?
Die Vertreibung ist die Strafe für den begangenen Hochverrat, als welcher die Auflösung der ersten Republik gewertet wurde und wird, an der die Sudetendeutschen die Schuld haben. „Die Sudetendeutschen kamen mit der Vertreibung gut davon, eigentlich hätte man alle erhängen müssen“, so die Aussage des tschechischen Ministerpräsidenten Zemann und, diese menschenrechtverachtende Aussage noch im Jahr 2002, 57 Jahre nach den zum Mord aufrufenden Reden und Dekreten eines Beneš.
Am Abschluss des Münchner Abkommens 1938, das in der Hauptsache den Anschluss der Sudetengebiete an das Deutsche Reich regelte, war kein Sudetendeutscher beteiligt, noch wurden die Betroffenen in einer Abstimmung nach ihrer Meinung befragt. Allerdings waren auch die Tschechen nicht direkt an den Verhandlungen beteiligt. Die „Alliierten“ (England und Frankreich), die schon 1919 keine Rücksicht bei der Staatsgründung der ČSR auf das „Selbstbestimmungsrecht der Völker“ genommen hatten, waren die Unterzeichner des Abkommens, von dem sie dann 1945 in Potsdam nichts mehr wussten.
So begann mit dem Kriegsende ein Leidensweg einer Volksgruppe, den man sich heute nicht vorstellen kann.
Bevor ab dem Frühjahr bis zum Herbst 1946 die sogen. amtliche Vertreibung unter Mitnahme von 30- 50 kg Gepäck (örtlich verschieden); keine Wertgegenstände, Sparbücher usw., erfolgte, herrschte für die Deutschen eine rechtlose Zeit. Mit Kriegsende begannen die in die deutschen Gebiete eingerückten Angehörigen der Swoboda-Armee, Rote Partisanen, SNB, nicht zu vergessen die Mitglieder der sich am Ort gebildeten Narodny Vybor, mit ihrer Schreckensherrschaft. In diesem Zeitraum 1945/46 verloren 260.000 Menschen ihr Leben.
Es war die Zeit der Enteignung, Wohnungsräumungen, wilden Vertreibungen, Verbringung zur Zwangsarbeit in Innerböhmen, Einweisung in KZ- und Arbeitslager, öffentliche Hinrichtungen ohne ordentliche Prozesse.
Als Grundlage und Vorwand für die Vertreibung von 4,1 Millionen Deutschen und Ungarn aus der ehemaligen Tschechoslowakei gelten 12 der von Edvard Beneš zwischen 1940 und 1945 erlassenen 143 Dekrete.
Beneš-Dekrete
Vertreibung und Enteignung:Dekret Nr.33 vom 2.8.1945. Es regelt die Aberkennung der Staatsbürgerschaft der deutschen Bevölkerung und anderer Einwohner der ehemaligen Tschechoslowakei. Darin wird erklärt, dass die Deutschen schon 1938 die tschechische Staatsbürgerschaft verloren haben. Die Sudetendeutschen waren nach dem Münchner Abkommen deutsche Staatsbürger geworden. Durch dieses Dekret wird auch deutschen Bürgern im Protektorat oder der Slowakei sowie den deutsche Juden im Protektorat, die niemals deutsche Staatsbürger waren, die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft entzogen.
Dekret Nr.27 vom 17.7.1945 und Nr.28 vom 20.7.1945; darin wird die Neubesiedelung der bis dahin deutschen Landesteile mit „slawischen Landwirten“. In Folge davon wurden 700.000 Deutsche gewaltsam vertrieben.
Dekret Nr. 137 vom 27.10.1945; es enthält die Bestimmung, dass Deutsche und Ungarn zum Zwecke ihrer späteren „Abschiebung“ unbegrenzt inhaftiert werden können.
Dekret Nr. 5 vom 19.5.1945 ordnet die nationale Verwaltung des Vermögens “staatlich unzuverlässiger Personen“ an.
Dekret Nr. 12 vom 21.6.1945 und Nr. 108 vom 25.10.1945; sie regeln die Enteignung zuerst des landwirtschaftlichen, dann des gesamten Besitzes der Deutschen und Ungarn. Grundlage der Enteignung waren weder eine persönliche Schuld noch die Staatsangehörigkeit, sondern allein die Volkszugehörigkeit.
Zwangsarbeit:
Dekret Nr. 71 vom 19.9.1945 und Nr. 126 vom 27.10.1945; sie regeln die Arbeitspflicht für Deutsche und Ungarn. Die eigentlichen Zwangsarbeiter erhielten kein Entgelt und waren im Allgemeinen inhaftiert. Für die anderen gab es Lohnabschläge, in Folge davon erhalten die heute noch in der Tschechei lebenden Deutschen weniger Rente.
Kulturelle Entrechtung:
Dekret Nr. 122 vom 18.10.1945 und Nr. 131 vom 6.5.1948; mit 122 wurden die deutschen Universitäten in Prag und Brünn aufgelöst. Die Absolventen verloren ihre akademische Grade, diese Diskriminierung dauert für heute noch in der Tschechei lebende Personen an.
Dekret Nr. 131 ordnet die „Liquidierung“ der Deutschen Evangelischen Kirche an.
Gewalt und Vergeltung:
Dekret Nr. 16 und Nr. 138 sogn. „Retributionsdekrete“. Mit diesen wurde eine Vergeltungsjustiz installiert. Bereits ein kleines Amt in einer NS-Organisation konnte mit 5 bis 20 Jahre Kerker bestraft werden. Über 38.000 Prozesse wurden geführt, 475 Todesurteile gegen Deutsche wurden vollstreckt, davon etliche öffentlich. Der tschechische Staat ist bis heute nicht bereit, damals verhängte Urteile zu überprüfen um Verurteilte zu rehabilitieren.
Mit dem Gesetz Nr. 115 vom 8. Mai 1946 wurden alle Taten für rechtmäßig erklärt, die an Deutschen bei der Vertreibung begangen wurden, dabei handelt es sich hauptsächlich um die Ermordung Zehntausender Deutscher. Das Gesetz gilt bis heute!
Wie kamen die Egerländer nach Baden-Württemberg, nach Wendlingen?
Auf 3 verschiedene Arten kamen die Egerländer nach Baden-Württemberg.
a) Bahntransport direkt vom Vertreibungslager:
das waren alle Transporte die über Furth im Wald in die US-Zone kamen. Es waren in der Hauptsache Vertriebene aus Mähren, Südböhmen und Ungarn, die nach Baden-Württemberg kamen; Egerländer kamen nur aus dem Südegerland, also aus den Kreisen Bischofteinitz, Tachau, Haid.
b) Familienzusammenführung:
Umsiedlung aus Hessen, Bayern, und der russ.Zone, wohin die Familienangehörigen mit dem Transport gekommen waren. Das lief im Allgemeinen so ab: ein Familienmitglied kam aus der Kriegsgefangenschaft oder im Rahmen der Arbeitssuche nach Württemberg fand hier (mit viel Glück) eine Arbeit und Bleibe und erhielt dann eine „Zuzugsgenehmigung“. Weitere Möglichkeiten waren, Verwandte, Bekannte aus der Kriegszeit, Kriegskameraden usw. am Ort, die dem „Flüchtling“ eine Bleibe gaben für ihn bürgten und er so zu dem lebendnotwendigen Papier „Zuzugsgenehmigung“ kam. Mit viel Geduld erfolgte dann die Suche nach dem Rest der Familie. War die Suche von Erfolg, begann dann der dornige Weg, auch für die Angehörigen das magische Papier „Zuzugsgenehmigung“ zu erhalten; denn nur damit war ein unbefristeter Aufenthalt an dem Ort, für den diese Genehmigung ausgestellt war, erlaubt. Jeder Ort durfte nur eine begrenzte Anzahl dieses Papiers ausstellen, das war abhängig von der Infrastruktur. Darauf achtete man damals streng, ganz im Gegensatz zu heute, wo jeder egal von wo und wie er daherkommt und sich einfach „niederlässt“. Damals spielten Wasserzuleitungen, Kläranlagen, Kanalquerschnitte usw. eine Rolle.
c) Einzel-Flüchtlinge:
Menschen auf der Suche nach Arbeit und einer Bleibe. Es waren entweder Personen die, aus welchen Gründen auch immer, aus der Heimat geflohen waren, oder die mit dem Transport in eine Gegend kamen, die auf die Dauer keinerlei Perspektiven hinsichtlich Arbeit und Beruf auch nur erahnen lies und deshalb in eine bessere Gegend wollten.
Warum nach Baden-Württemberg?
In den Jahren 1945/46 gab es so gut wie keine öffentlichen Medien. Nachrichten erreichten dir Interessenten hauptsächlich über die „Buschtrommel“, so auch die Nachricht, in Württemberg gibt es Arbeit und „Zuzug“.
So kamen Egerländer, die in der Hauptsache nach Bayern und Hessen mit den Transporten gekommen waren , dort aber so gut wie keine Arbeit finden konnten, außer in beschränktem Umfang in der Land und Forstwirtschaft, als Einzelpersonen nach Württemberg. Es kamen aber auch Vertriebene aus der russischen Besatzungszone als Flüchtlinge über die bewachte Demarkationslinie.
Einige der Egerländer kamen aber auch als Flüchtlinge dort an. Als es Ende 1945 Anfang 1946 in der CSR für Deutsche immer unerträglicher wurde, die Verhaftungswelle rollte und Deportationen als Zwangsarbeiter ins Innere Böhmens wurden immer häufiger. Die dortige Landwirtschaft brauchte kostenlose Arbeitskräfte, da die ehemaligen Knechte als „Goldgräber“, amtliche Bezeichnung „Narodny Spravce“, in die deutschen Gebiete abgewandert waren, das Gleiche galt auch für den Bergbau in Brüx und Kladno. Um dem zu entgehen, flüchteten viele der im grenznahen Gebiet wohnhaften Egerländer über die grüne Grenze nach Bayern. Sie brachten meistens nur einen Rucksack an Habe mit, also viel weniger als die von den Amerikanern vorgeschriebenen 50 kg Gepäck. Oftmals wurde dann mehrmals ein lebensgefährlicher Weg über die Grenze angetreten um noch dies oder jenes aus der inzwischen versiegelten Wohnung zu holen. Wer dabei erwischt wurde, dem war außer Schlägen eine längere Haft sicher; es sei denn, er wurde auf dem Rückweg erwischt und die Grenzsoldaten fanden Gefallen an der mitgeführten Habe.
Nach dem illegalen Grenzübertritt, fanden sie meistens bei Verwandten oder Bekannten in der Oberpfalz für kurze Zeit eine Bleibe. Man musste sehen, dass man einen „Registrierschein“ der Amerikaner bekam. Es gab Registrierstellen, meistens bei der örtlichen „Military Gouvernement“ – Stelle untergebracht, wo an bestimmten Tagen und nur für kurze Zeit geöffnet war. Der Registrierschein
war ein Blatt Papier in englisch und deutsch, versehen mit einem Fingerabdruck des rechten Zeigefingers. Die amerikanischen Beamten nahmen es oftmals recht genau, fragten die Leute aus und es kam vor, dass es statt eines Registrierscheines, ab in ein Kriegsgefangenen-Lager oder zurück über die Grenze ging, was gleichbedeutend mit tschechischem Lager war. Der Registrierschein war ein Ausweispapier, das aber kein Bleiberecht beinhaltete. Man konnte darauf bei einem den Flüchtlingen gut gesinnten Bürgermeister für 3 Tage „Reise-Lebensmittelmarken“ bekommen.An einem Ort länger als 3 Tage bleiben konnte man nur mit einer „Zuzugsgenehmigung“, die aber im Allgemeinen wiederum den Nachweis einer Arbeitsstelle und Unterkunft voraussetzte. Die Gemeinden bez. Landkreise hatten strenge Auflagen bei der Vergabe des begehrten Dokumentes. Eine große Rolle spielte die Infrastruktur, auf die man heute keinerlei mehr nimmt. Wen wundert es, wenn Kläranlagen und Kanalsysteme heute bei geringer Überbelastung durch Witterungseinflüsse ihren Dienst versagen. Konnte man aus eigener Kraft keine Bleibe finden, blieb nur der Weg über die „Auffanglager“, wie z.B. Hof-Moschendorf, München Allach, um nur einige zu nennen. Das bedeutete aber längerer Lageraufenthalt mit allen Konsequenzen, oftmals peinliche Befragungen durch die Besatzungsstellen und zum Schluss, Zuteilung auf irgendeinen Landkreis, was wiederum Eintritt in den Teufelskreis bedeuten konnte –Suche nach Arbeit, da es diese an dem Ort, den man zugeteilt worden war, absolut nicht gab. Arbeit war inzwischen sehr wichtig geworden, denn die spärlichen Lebensmittel, die es auf Marken gab, mussten mir RM bezahlt werden und die musste man irgendwie verdienen. „Sozial“, wie heute, gab es damals nicht und die „Flüchtling“ hatte man aller Barschaften erleichtert. Retten konnte man nur Geld über ein Postsparbuch; glücklich der, der ein solches über die Grenze retten konnte, er konnte davon abheben. Alle anderen Sparbücher, die man vor den Tschechen retten konnte, waren vorerst wertlos.
Die Suche nach Arbeit und damit „Zuzug“ dauerte oft recht lange. Wendlingen bzw. der damalige Landkreis Nürtingen , mit einem Landrat Dr.Schaude an der Spitze waren ein Glücksfall für viele Vertriebene und damit die Egerländer. Hier wurde für die Vertriebenen viel getan, im Vergleich mit anderen Landkreisen, vor allem im Vergleich zu Bayern oder Hessen, wurde sehr, sehr viel getan.
Oskar Storm, Neuhausen/Filder, Feber 2004
Quellen: Konrad Badenheuer, Beneš-Dekrete. Karlsbader Zeitung, 53. Jahrg. 6/2003, Seite 210:
Nachdruck aus „Bayernkurier“ vom 17.4.2004
[zurück zum Inhaltsverzeichnis]
Die Egerländer als Bürger Wendlingens
Die meisten Egerländer kamen bis Ende 1946 nach Baden-Württemberg, hatten eine - irgendeine- Arbeit gefunden und hatten ein Dach über dem Kopf und das schlimmste Jahr nach dem Krieg -1947- vor sich. Trotzdem resignierte kaum jemand und nach der Währungsreform 1948 begann der Aufbau einer neuen Existenz. Aber bei den meisten, besonders bei den älteren Vertriebenen wurde alles immer im Hinblick auf die Rückkehr in die Heimat geplant und getan. Im Hinterkopf war der Gedanke, dass es nur für kurze Zeit sei, sich alles beruhigen würde und man daheim weitermachen würde. Dass ein derartiges Unrecht von Dauer sei, konnte sich niemand vorstellen.
Im Jahr 1949 erfolgte die offizielle Gründung der Gmoi Wendlingen und auch etlicher Gmoin in Baden- Württemberg. Viele Egerländer hatten sich aber schon vorher immer wieder zusammengefunden, ohne feste Termine und Planung zum „Hutzn“ getroffen und standen einander mit Rat und Tat in der schweren Zeit bei.
Die Gmoi Wendlingen war von Anfang an bestrebt sich nicht abzukapseln, sondern sich nach außen zu öffnen und am öffentlichen Leben Teil zu nehmen. Das geschah als Gmoi, aber auch als einzelnes Gmoimitglied. Egerländer wurden Mitglied in örtlichen Vereinen, waren Mitglied des Gemeinde- und Kreisrates und brachten ihren Beitrag zum Geschehen in der Stadt.
Im Jahr 1952 fand das 1.Vinzenzifest der Egerländer statt, das Fest, das inzwischen zum Stadtfest, zum größten Fest in der Region Mittlerer Neckar geworden ist. Nur am Rande sei hier vermerkt, dass dieses Fest zwar die Hilfe der Gemeindeverwaltung erfährt, wie dies bei Festen anderer Vereine auch üblich ist, bis heute aber von der Egerländer Gmoi z´Wendlingen die Logistik erbracht und das gesamte finanzielle Risiko getragen wird.
Ab dem 2.Vinzenzifest 1953 findet am Festsonntag der Vinzenzimarkt statt, der inzwischen den Köngener Pfingstmarkt weit hinter sich gelassen hat. Eine weitere Attraktion der Stadt Wendlingen am Neckar seit nunmehr über 50 Jahren ist das 1950 von den Egerländern wieder ins Leben gerufene und in Wendlingen fest etablierte Maibaumfest, ein Fest, das andere Gemeinden jetzt versuchen im Jahresablauf zu etablieren. Natürlich sind die Egerländer Feste von Anfang an unter Beteiligung der örtlichen Vereine begangen worden.
Aber nicht nur beim Feiern waren die Egerländer tonangebend, auch am Ernst des Lebens der Gemeinde leisteten sie ihren Beitrag. Die Vettern Anton Rödl und Hubert Matzner waren Mitglied im Gemeinde- und Kreisrat. Sie waren nicht nur Mitglied, sie erhoben auch, wenn es nötig war, lautstark ihre Stimme. Und ein Egerländer, Hans Köhler, leitete die Geschicke der Stadt Wendlingen am Neckar von 1978 bis 1993. Unter seiner „Regentschaft“ wurden viele Projekte verwirklicht, die den heutigen Stellenwert Wendlingens mit ausmachen. 1988 schenkten die Egerländer der Gemeinde für die Neue Stadtmitte den Egerländer Musikantenbrunnen und schon 1976 sorgten die Egerländer für den Ausbau der Vinzenzikapelle in St.Kolumban, in der seit 1981 das Reliquiar des Hl.Vinzenz aufbewahrt wird; Kapelle und Reliquiar sind eine Stiftung der Egerländer an die Kirchengemeinde. Auf dem Friedhof wurden zwei Gedenkstätten für die Vertreibungsopfer auf Anregung und mit der Finanzierung durch die Egerländer errichtet und an die Übernahme der Patenschaft über alle in Baden-Württemberg lebenden Egerländer durch die Stadt Wendlingen am Neckar erinnert eine von der Gmoi z´Wendlingen gestiftete Bronzetafel.
Das sind nur einige Beispiele der Spuren, die die Egerländer in Wendlingen hinterlassen haben und es immer noch tun.
Oskar Storm, Neuhausen/Filder, Juli 2003
Quellen: Archiv der Egerländer Gmoi z´Wendlingen am Neckar.