 |
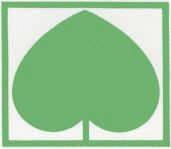 |
Egerländer Gmoi Wendlingen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
zurück |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Geschichte | Vinzenzifest
Vinzenzifest - Birnsunnta
Das 1. Vinzenzifest fand am 6. Dezember 1693 in Eger statt. Der sichtbare Anlass dazu war die feierliche Überführung der Reliquien des Hl. Vinzentius in die Stadtkirche St. Niklas. Der tiefere Grund dafür ist wohl in dem erfolgreichen Abschluss der Gegenreformation in Eger und seinem Umland zu suchen.
Am 4. Feber 1652 befahl Kaiser Ferdinand III. dem Rat der Stadt Eger, mit dem Reformationswerk fortzufahren, allen Untertanen in Stadt und Land ohne Ansehen der Person einen Termin auf zwei Monate zur Bekehrung anzusetzen und alle jene, bei denen keine Hoffnung zur Rückführung zum Katholizismus bestehe,
wie bereits anno 1629 und 30 geschehen, zur Emigration anzuhalten und verfügte, dass diese ohne kaiserliche Einwilligung nicht wieder in das Land kommen dürften. In einem Schreiben an das bischöfliche Konsistorium in Regensburg vom 5. Juni 1652 berichtete der Rat der Stadt, dass diese Aktion mit Erfolg im Gange sei. Aber erst aus dem Jahre 1673 findet sich ein letzter Bericht der Reformationskommissäre in den Akten des Egerer Stadtarchivs.
Zu Beginn der neunziger Jahre waren nachweisbar die letzten zwangsweise katholisch gewordenen Bürger Egers gestorben; damit konnte die Gegenreformation als restlos abgeschlossen betrachtet werden. Als äußeres Zeichen dieses endgültigen Sieges des Katholizismus erhielt Eger um diese Zeit die Reliquien des in der römischen Kaiserzeit als Märtyrer durch das Schwert hingerichteten Hl. Vincentius, dessen Leichnam in Rom nahe der Via Amelia beigesetzt war.
Als Papst Alexander VIII. die sterblichen Überreste des Heiligen bergen ließ, übergab er diese kostbaren Reliquien dem Kardinal Graf von Kolonitsch, der sie im Jahre 1689 nach Wien überführen ließ.
Der Kardinal Johann Leopold Graf von Kolonitsch, der lange Jahre Kommandeur der in Eger bestandenen Maltheserkommende gewesen war, ein der Stadt Eger und deren Bürgern wohlgesonnener, frommer Mann stiftete diese Reliquie 1692 der Kirche St. Niklas zu Eger. Ihre Übergabe an die Abgesandten der Stadt, Bürgermeister Johann Philipp Martini und Syndikus Adam Christoph Wagner, erfolgte am 8. Oktober 1693 in Wien. Da bei deren Rückkehr nach Eger am 18. Oktober die Vorbereitungen zur feierlichen Übertragung der Reliquie in die Stadtpfarrkirche noch nicht beendet waren, wurde sie zunächst auf dem Altar der Rathauskapelle beigesetzt.
Für die feierliche Überführung in die Stadtkirche wurde der Gedenktag des Patronatsheiligen St. Niklas, Sonntag der 6. Dezember bestimmt und Papst Innozenz XII. gewährte aus diesem Anlaß einen vollkommenen Ablaß. In der verbleibenden Zeit wurde ein kostbarer Reliquienschrein angefertigt und die kirchliche Feier vorbereitet, zu der sämtliche im Egerer Land gelegenen Kirchspiele eingeladen wurden.
Der Jesuitenpater Johann Miller schreibt in seiner, erstmals 1694 bei Nikolaus Dextors Witwe in Eger gedruckten „Egra sancta, das ist Kurtzer Bericht von denen heiligen Reliquien, welche in der Stadt Eger aufbewahrt werden“, über den Ursprung des Festes:
"Der Leib des heiligen Vinzenz, römischen Märtyrers, wurde auf Befehl Sr. päpstlichen Heiligkeit Alexander VIII. aus seiner bisherigen Ruhestätte erhoben und dem Kardinal Johann Leopold Grafen v. Kolonitsch am 16. November 1689 zu Rom eingehändigt, welcher diese kostbare Reliquie nach Wien überführen ließ. Kardinal Graf v. Kolonitsch war lange Jahre Kommandeur der in Eger bestandenen Maltheser-Kommenda. Aus Anhänglichkeit an diese Stadt verehrte derselbe die obenerwähnte Reliquie, welche sich bis zum 8. Oktober 1692 in seinem Palaste zu Wien befand, der Kirche zum Hl. Niklas in Eger. Die Übergabe des Leichnams Sancti Vincentii erfolgte an die Abgeordneten der Stadt Eger, nämlich an den Bürgermeister Johann Philipp Martini und den Syndicus Adam Christoph Wagner zu Wien an demselben Tage. Am 18. Oktober des gleichen Jahres traf die Deputation wieder in Eger ein und da die nötigen Anstalten zur öffentlichen feierlichen Übertragung in die Stadtpfarrkirche zum Hl. Niklas noch nicht beendet waren, so wurde die Reliquie einstweilen auf dem Altar in der alten Kapelle des Rathauses beigesetzt. Die Freude über dieses Ereignis war in Eger eine allgemeine. Der Magistrat betrieb mit Eifer die Vorbereitungen zum möglichst feierlichen Umgange. Es wurde ein schöner kostbarer Reliquienkasten angefertigt. Se. päpstliche Heiligkeit Papst Innocenz XII. verlieh für den Übertragungstag einen vollkommenen Ablaß. Zur feierlichen Übersetzung, wurde der 6. Dezember 1693, der Gedächtnistag des Hl. Niklas, welcher damals auf einen Sonntag fiel, festgesetzt. Hiezu wurden alle im Egerlande gelegenen Kirchspiele eingeladen. Die Einwohner der Stadt hatten sich tags vorher durch freiwilliges Fasten hiezu vorbereitet. Mit anbrechendem Morgen versammelte sich das Volk aus der Stadt und den geladenen Kirchspielen in der Kirche, von da aus begab es sich nach gehaltener Frühmesse und Predigt prozessionsweise vor das Rathaus, wo ein Theater aufgerichtet war und ein auf das eben beschriebene Fest bezugnehmendes religiöses Schauspiel von der studierenden Jugend aufgeführt wurde. Nach dessen Beendigung setzte sich der Zug in folgender Ordnung in Bewegung. Den Anfang machte die deutsche Schuljugend mit ihrer Fahne, ihr folgten die eingepfarrten Dorfschaften Albenreut, Treunitz, Lohma, Trebendorf, Nebanitz, Mühlessen, Frauenreut und Mühlbach. Nun kamen in ihrer Ordnung die lateinische Bruderschaft Unserer lieben Frau mit ihrer Fahne, Umbelle und dem Bildnis Mariä, die Stadt- und Kirchenmusiker, die Glieder des Ordens des Hl. Franziskus und des Dominikanerordens. Nach diesen Religiosen folgten 40 schön gekleidete Knaben, vier und vier, in deren Mitte die Statuen des Hl. Niklas und der Hl. Elisabeth, als Patronen der Pfarrkirche, getragen wurden, darauf die Kuratgeistlichkeit im Kirchenornate und darnach der Reliquienkasten mit dem Hl. Leichnam, von acht Priestern getragen, welchem der Stadtmagistrat, der Adel, die Bürgerschaft, Bruderschaften und endlich die übrigen andächtigen Teilnehmer des Umganges folgten.. Während der Prozession wurde mit allen Turmglocken geläutet. Auf dem Ring stand die Stadtgarnison mit fliegender Fahne unter klingendem Spiele in Gewehr. Die Prozession nahm ihren Weg durch die vornehmsten Gassen über den Stadtring in die Pfarrkirche, wo die heilige Reliquie auf dem dazu bestimmten Altar beigesetzt wurde. Den Beschluss dieser erhebenden Feierlichkeit machten eine Lobpredigt und ein feierliches Hochamt mit dem ambrosianischen Lobgesänge."
- Ausführlicheres über das aufgeführte „religiöse Schauspiel“ findet sich in „Salomon Grubers Chronik“:
„An den Fest selbsten hat sich gleich bey Anbrechenden Tage sowohl das Stadt als land Volk aus allen Kirchspielen in grosser Menge in alhiesiger Pfarr Kirche versamlet, und nach gehaltener Fruh-Meß und Fruh-Predig, ist solches von da aus processionaliter hinauf vor das Rathhauß gezogen; es ware aber bey diesen ein Theatrum, oder Schaubühne aufgerichtet, und auf solcher von der alhier studirenden Jugend dem versamleten Volke eine kleine Comoedi in teutscher sprache vorgestellet, dero Inhalt ware folgender: I. Aufzug. Das christliche Rom deren alten Christen heltenmuth als welche so ritterlich, und in so grosser Menge den Christlichen glauben durch allerley Marter gattung verfochten, das Römische gebiethe mit ihrem blute befruchtet, und ihren Gebeinen geheiliget haben. II. Aufzug. Die Seelen deren heiligen Martyrer frohlocken ob ihrer ewigen glückseeligkeit, erinnern doch dabey, wie ihre gebeiner in denen Römischen Freydhöfen und Krufften schon so viele Jahre unbekannter liegen, verlangen aufgehoben und denen Christen zum besten in alle länder vertheilet zu werden, welches zu bewerkstelligen der römischen Clerysey anbefohlen wird. III. Aufzug. Diese füllet das Apostolische Sacrarium oder Heiligthums Kamer mit aus unterschiedlichen Freydhöfen erhobenen Heiligenleibern an, welche der Römische Stuhl unterschiedlich geistlich- und weltlichen Ständen, und Städten vertheilet; Ihro hochfürstliche Eminenz dem Herrn Kardinal von Kollonitz kommet der leib des heil. Martyrers Vinzentij zu Theil, welche (sic!) seine Eminenz der Stadt Eger verehret. IV. Aufzug. Die länder, Berge und Wälder, Felsen und Bäume, durch welche der heilige leib des heil. Vincentij geführet wird, frolokken und erfreuen sich wegen eines so werthen Gastes Ankunfft und durchzuge, begleiden ihm mit singen, Tanzen, und dergleichen Jubelzeichen bis an ihre gränze. V. Aufzug. Eger rnachet Anstalt einen so heiligen gast zu empfangen, ruffet alle heilige Stadt Patronen, und deren Junwohner Schutz Engel zusamen, den heil. Vincentium zu bewilkornmen. VI. Aufzug. Das Egerische Rathhauß saget dem heil. Vincentio demüthigen Danck, dass er in alldasiger capell einige Zeit gewohnet hat, bittet um Seegen, Schutz und Schirm für sich und die ganze Bürgerschafft, ermahnet auch alle, dass sie nicht allein an den heutigen Tag die heil. Reliquien mit größter Andacht begleiden, sondern auch hinfüro zu ewigen zeiten den heil. Vincentium als ihren Schutz Patron verehren sollen“.
Soweit zu den feierlichen Anfängen der Verehrung des hl. Vincentius in Eger und den umliegenden Pfarrgemeinden. Ob der Umzug von da an beibehalten wurde oder ob das Vinzenzifest in den nächsten 50 Jahren nur in der Kirche selbst gefeiert wurde, wissen wir nicht, ebenso wenig seit wann dieser festliche Umzug, der den Mittelpunkt des Egerer Erntedankfestes bildete, auf den letzten Sonntag im August verlegt wurde (Birnsonntag).
Erst aus in einem Bittgesuch des Magistrats an das bischöfliche Konsistorium in Regensburg vom 30. Juli 1746 wird wieder Näheres über die Vinzenziverehrung bekannt.
In dem Bittgesuch schreiben die Egerer, dass die Stadt und der ganze Bezirk die schweren Heimsuchungen des letzten Krieges - gemeint ist die Besetzung und Ausplünderung der Stadt durch die Franzosen während des Österreichischen Erbfolgekrieges - einigermaßen glimpflich überstanden haben. Sie verdankten dies „nebst der allerhöchsten göttlichen Majestät, auch der großen Fürbitt der hiesigen heiligen Stadt-Patronen, insonderheit aber des heyl. Märtyrers Vincentii, dessen heil. Leib wir hierorts zu verehren haben“. Dafür fühlten sie sich zu einer immerwährenden Danksagung verpflichtet. Sie hätten sich deshalb vorgenommen, „das den letzten Sonntag des Monats Augusti einfallende festum des gedachten hiesigen heiligen Stadtpatrons Vincentii Jahr zu Jahr mit hiesigen eingepfarrten Bezürcks-Inwohnern mittelst Anstellung einer solennen Procession, bey welcher der heil. Leib mehrgedachten heil. Stadtpatrons Vincentii herumbgetragen wird, feyerlichst zu begehen“. Sie hätten diesen „speziellen Devotionsakt“ auch schon „die verflossene beede Jahre hindurch“, seit der Krieg zu Ende war (1744), ins Werk gesetzt. Die Pfarrer der Egerer Dorfschaften mit ihren Pfarrkindern hätten sich auf die an sie ergangene Einladung hin zur Prozession eingefunden und so mitgeholfen, die „Solennität“ (Festlichkeit) zu begehen. Weil die Egerer nun „mit sothaner specialen Andacht beständig zu continuiren gedenken“, richte man an das bischöfliche Konsistorium die Bitte, dies zu gestatten und die Pfarren des hiesigen Bezirks zur Teilnahme an diesem „Danksagungsfest“ für den Stadtpatron offiziell zu verpflichten.
Es ist nicht zu bezweifeln, dass der Magistrat eine zustimmende Antwort aus Regensburg erhalten hat und man wohl davon ausgehen kann, dass die Prozessionen über den Marktplatz und die Hauptstraßen erst seit 1744 wieder stattgefunden haben.
Da der Legende nach an dem Tag, an dem die Reliquie von Rom bzw. Wien kommend in Eger eingetroffen war, eine „da herrschende Pest“ schlagartig aufhörte, kamen die Gläubigen in allerlei die Gesundheit betreffenden Anliegen , bevorzugt bei ansteckenden Krankheiten und bei Kopfschmerzen (Kopfreliquie!), zu seinem Heiligtum in St.Niklas.
Der von der Fleischerzunft gestiftete Vincentiusaltar trägt die Inschrift „veni, vidi, vici“- eine Anspielung freilich auch auf den charakteristischen Katakombenheiligen-Namen Vincens = der Siegende- und nicht nur im Hinblick auf den Sieg über die Pest. Über dem Reliquienschrein, der bei der Vinzenziprozession mit durch die Stadt getragen wurde, steht der hl. Vincentius, flankiert von zwei Heiligen; unter dem Altartisch ist das Zunftzeichen der Altar-Stifter, der Egerer Fleischerzunft und das Egerer Stadtwappen angebracht. Der Altar kündet auch heute noch von der Jahrhunderte langen deutschen Vergangenheit Egers.
Vor allem war Vinzenz aber der Stadtheilige; das unterstreicht auch das bei zu seinen Ehren abgehaltenen Andachten gern gesungene vielstrophige Vinzenzilied, dessen sechste Strophe lautet:
Beschütze Eger, Stadt und Land, o Schutzpatron,
vor Hunger, Pest und Feuersbrand, o Schutzpatron!
0 Vizenzi, o Vizenzi, o Vizenzi, Schutzpatron!
Sein Feiertag war ein Stadtfest, das trotz der solennen Prozession nicht eigentlich als Wallfahrt zu bezeichnen ist.
Es gibt zahlreiche Berichte über den Verlauf des Festes, das immer am letzten Sonntag im August begangen wird. Prominentester Berichterstatter ist wohl J.W.Goethe, der dieses typische egrische Stadtfest schon als Erntedankfest miterlebt hat.
Johann Wolfgang Goethe weilte wiederholt in Eger, das erste Mal vermutlich im Jahre 1785 auf seiner Reise nach Karlsbad oder im September 1786, als er von Karlsbad kommend über Bayern und Tirol nach Italien reiste. Damals bemerkte er übrigens, dass Eger unter demselben Breitengrad liege wie seine Vaterstadt Frankfurt. Immer wieder übten die drei Egerländer Weltbäder Franzensbad, Karlsbad und Marienbad eine besondere Anziehung auf ihn aus, äußerte er sich doch einmal, er würde drei Orte zum ständigen Wohnsitz bevorzugen: Weimar, Karlsbad und Rom. Und so lag es nahe, auch Eger öfter aufzusuchen, zumal er hier in Magistratsrat Grüner, in Karl Huß, dem letzten Egerer Scharfrichter, dessen reichhaltige Münzen- und Antiquitätensammlung Goethe besonders gefiel, und in dem musikverständigen Ratsherrn Gabler von Adlersfeld eine ansprechende Gesellschaft fand. Goethes Tagebücher geben viele Eintragungen wieder, aus denen man entnehmen kann, wie er häufig, begleitet von Magistratsrat Grüner, die engere und weitere Umgebung Egers in vielen Einzelheiten kennen lernte.
Einen besonderen Eindruck machte auf ihn das Egerer Stadtfest mit der Vinzenziprozession, das er in seinen Tagebuchaufzeichnungen vom 26. August 1821 und vom 25. August 1822 schildert:
"Eger 26. August 1821. St. Vincenzitag, großes Fest in Eger. Mit Polizeirath Grüner auf den Ring und in die Hauptkirche gegangen; Die Stadt sehr lebhaft, die Prozessionen von neun Pfarreien mit ihren untergeordneten Ortschaften zogen von 7 Uhr an einzeln in die Stadt, in die Hauptkirche, von wo aus um 10 Uhr die große Prozession ausging. In langen Reihen, erst die Schulmädchen, dann die Schulknaben, ferner die Gymnasiasten, darauf die Handwerker mit ihren Fahnen, die Schützenkompagnie, die Geistlichkeit, auch Mönche, zuletzt der Dechant, welcher den mit Perlen und Edelsteinen eingehüllten Schädel des Heiligen Vincenz trug, sodann Rat und Honorationen. Zuletzt ein Schwall von Männern, alle Dorfschaften waren zusammengeschmolzen, sowie zuletzt auch ein gleicher Strom von Weibern, den Kopf meistenteils mit einer seltsam gekniipften Serviette ausgeputzt. Dieses allgemeine Volks- und Stadtfest war vom schönsten Sonnenschein begünstigt .
Nachdem alles auseinander gegangen, blieb die Menge noch truppweis stehen, versammelte sich aber um die Wagen voll Birnen welche von Bayreuth und aus dem Saazer Kreis her zu diesem Feste gekommen waren.
Vor allem wäre zu sagen, dass Eger einen der schönsten Marktplätze hat, der Ring genannt, zwar ansteigend, aber durchaus mit schönen Gebäuden umgeben. An der einen Seite dieses Platzes zog die Prozession herauf, verlor sich in anstoßende Straßen, kam aber unten wieder hervor, um den ganzen Raum zu umgehen, welches sich sehr gut ausnahm“.
Als ein weiterer Berichterstatter soll der Liedersammler Albert Brosch zu Wort kommen. Hier, seiner Liedersammlung entnommen, das von ihm aufgezeichnete Vinzenzilied und sein Bericht:
„Egerer Vinzenzi-Prozessionslied
Aufgezeichnet von Albert Brosch, Eger 1940, Vorsänger: J. Gottfried.
(aus: Albert Brosch, der Liederschatz des Egerlandes, Band III, S 243 f )
1. Wir kommen nun von weitem her, o Schutzpatron
Und singen Dir zu Lob und Ehr, o Schutzpatron !
Refrain: O Vi(n)zenzi, o Vi(n)zenzi, o Vi(n)zenzi Schutzpatron !
2. Zum Wohnsitz hier bist Du bestellt
und diesen Ort Dir auserwählt. Refrain:
3. In der Not, da steh uns bei.
Von allem Uebel mach uns frei! Refrain:
4. Hör unsre Seufzer an,
Dass Gott bestimmt uns helfe dann! Refrain:
5. Nothelfer für uns Du nun bitt,
Dass Gott uns dann den Frieden gibt. Refrain:
6. O beschütze Stadt und Land
Vor Hunger, Pest und Brand. Refrain:
(Dafür auch: 6. Beschütze Eger, Stadt und Land, Erlöse es aus Feindeshand! )
7. Du erhabner Glaubensheld,
Gott hat Dich so hoch gestellt! Refrain:
8. Ich komm mit meinem Kreuz und Leid
Und suche bei Dir Trost und Freud. Refrain:
9. Bitte Lass das Hoffnungslicht
Wie durch jedes Dunkel bricht. Refrain:
10. Zu Dir schick' ich nun meinen Gruß
Und fall in Demut Dir zu Fuß. Refrain:
11. Deine Fürbitt ruf ich an,
Hilf, dass ich Dir folgen nun kann! Refrain:
12. Dass mein Herz so treu vertraut
Wie mir klar Dein Auge schaut. Refrain:
13. Bitte, dass mein Glaube steh
Fest und froh in Kampf und Weh. Refrain:
14. steh uns bei am letzten End
Und bringe uns das Sakrament. Refrain:
15. Sprich: Es gibt kein Trauern mehr,
Sieh, Dich ruft der Vater her. Refrain:
16. Komm mit den Schutzengeln all
Und führe uns in den Himmelssaal! Refrain:
Am Vinzenzisonntag, das war der letzte Sonntag im August, fand in Eger das „Fest“ statt. Vormittags war kirchliche Feier, zu der die Bewohner der umliegenden Dörfer (Stadt - Egerer Patronat) mit ihren Kirchenfahnen anrückten. Bei der die Kirchenfeier abschließenden Prozession am Marktplatz wurde unser Lied gesungen. Der Marktplatz bot ein buntes Bild: Rund herum zog die Prozession und in der Mitte waren zahlreiche Verkaufsstände mit Obst und Süßigkeiten. Nach Schluß des Umzuges stürzte sich alles, Groß und Klein zu den Obstbuden und von den vielen Birnen, die da gekauft wurden, hieß der Tag auch „Birnsonntag“. Nachmittags war das Volksfest auf der „Pröllwiese“.
Die Weise des Vinzenziliedes war sehr beliebt und im ganzen Egerland bekannt; ich habe aber nirgends eine Aufzeichnung davon gefunden.
Weil, wie gesagt, der Marktplatz mit Obstständen gefüllt war, wurde das Lied auch parodiert:
O Vizenzibirn,
Enk mou ma ojastiern.
Wal(d)s sua schäina råuta Backla håuts!
Und auf ältliche Jungfrauen:
0 Vinzenzi Schurzbandlmoa(n)!
(gesprochen): B'scher ma a ran Moa(n)!
Zur Weise vgl. „Ditfurt“ I/153, S.44. Gleiche Weise haben 1252 (Maria Kulm-Einzugslied), 1294 (Kappl bei Waldsassen - Zur hl. Dreifaltigkeit)“.
So weit der Liedersammler Albert Brosch.
Der Verlauf des Festes, war über die Jahrzehnte hinweg immer gleich. Am Vormittag große Prozession und Gottesdienst, wobei der Mittelpunkt der Reliquienschrein mit dem Haupt des Vincentius war. Am Nachmittag, Festzug mit Musik, Trachtengruppen, Motivwagen und anschließenden Festtreiben auf der Brühlwiese (Pröll), der Endstation des Festzuges.
Mit dem Krieg und endgültig durch die Vertreibung 1945/46 endet die Tradition des Vinzenzifestes in Eger jäh und für immer.
Mit dem Krieg und endgültig durch die Vertreibung 1945/46 endet die Tradition des Vinzenzifestes in „Stadt und Land Eger“, nicht aber bei den Egerländern. Obwohl die „Neuen Herren“, unsere Vertreiber, gern und sehr viel von uns Geschaffenes als ihre Errungenschaft übernommen haben, die Reliquie und das damit verbundene „Fest“ blieb bis heute unangetastet, wohl nicht zuletzt wegen der geringen Zahl Katholiken, gläubiger Katholiken in „Cheb“ und dem gar zu sichtbaren deutschen Charakters des Festes.
Die Tradition dieses ältesten, in seinem Sinn und Wesen unversehrt gebliebenen kirchlichen und volkstümlichen Festes fortzuführen, wurde Aufgabe der Vertriebenen Egerer und Egerländer, nachdem sie den ersten durch die Vertreibung erlittenen Schock einigermaßen überwunden hatten. Auf diese Weise wurde ein Stück friedliche Vergangenheit in die Zukunft getragen, in der die Egerländer Volkskultur in allen ihren Erscheinungsformen lebendige Erinnerung und gelebte Wirklichkeit bleiben soll. An den neuen Orten, in Schirnding seit 1949 und in Wendlingen am Neckar seit 1952, wurde das Vinzenzifest wieder zum „Stadtfest“. Durch die sich ändernten Zeiten, andere Menschen und die neue Umgebung, hie und da in etwas geänderter Form, im Kern aber das Vinzenzifest,- am Vormittag Prozession mit Gottesdienst, am Nachmittag Festzug und Festtreiben mit Vinzenzi-Markt.
Das Fest war, wie alles Lebendige, einem langsamen aber stetigen Wandel unterworfen, nach 1945 aber erfolgte, bedingt durch die Zeitumstände, ein jäher Wandel des Vinzenzifestes.
Aus dem, zu Beginn rein kirchlichen Fest, aus dem später zugleich das Erntedankfest, der "Birnsunnta" wurde und zunehmend auch säkulare Züge annahm, wurde jetzt als dritte Komponente die Vertreibung, das erlittenen Unrecht in verschiedener Form in den Festverlauf aufgenommen. Die Änderungen der letzten 50 Jahre, die nicht minder einschneidend waren, erfolgten eher schubweise (so paradox es ist, seit Anfang der 80iger Jahre gibt es parallel zur Festmesse einen evangelischen Gottesdienst. Seit Öffnung des eisernen Vorhangs nimmt eine Abordnung der Stadt „Cheb“ mit dem jeweiligen Oberbürgermeister an der Spitze, am gesammten Fest, auch der Prozession teil).
An einigen Daten soll die Weiterentwicklung und, wie schon gesagt, auch manche Veränderung des Festverlaufes und seines Inhaltes für Wendlingen am Neckar aufgezeigt werden.
Vorher aber ein Bericht („Eghalanda Bundeszeiting“, 1. Jahrgang, Folge 2, 1950, Seite 17.) vom „Birnsunnta“ in Schirnding, der die Änderung zu den Festen in Eger sehr deutlich zeigt:
2. Egerer Birnsunnta in Schirnding
„Am 26. und 27. August fand der 2. Birnsunnta in Schirnding bei Eger statt. Wir entnehmen der Egerer Zeitung folgenden Bericht:
Am Bahnhof Schirnding empfing eine starke Musikbande jeden eintreffenden Zug der Festgäste mit dem Egerländer Marsch. Am 26. rollte ab 14 Uhr alle 30 Minuten ein Autobus zu den Blickpunkten in die verlorene Heimat. - Am Festabend begrüßte Dr. Zechel, Bundesverkehrsminister Vetta Dr. Seebohm, dann die M. d. B., Dr. Zawadil (Olrnütz) und Weikert, Vertreter der Regierung von Oberfranken, des Landkreises Wunsiedel mit Landrat Zeitler ...
Dem Festabend (gestaltet vorn Schirndinger Gesangverein, Turnverein Schirnding, Musikverein und Vetta Fritsch Benno), lief ein Volksturnsabend im großen Festzelt parallel (Gestaltung: Jugendgruppen Wunsiedel, Arzberg, Hohenberg, Schirnding; Klofat, Doll Voit).
Am nächsten Tag trafen die Festzüge ein; bis aus Salzburg und bis aus Freiburg i. B. kamen unsere Landsleute an die Grenze. Den katholischen Festgottesdienst (Mundartpredigt von Hw. Pfarrer Kaas, Wondreb) besuchten 5000 Personen. In der Turnhalle versammelten sich die Kunstfreunde beim Konzert der Bayreuther Syrnphoniker (Musikdirektor Thamm). Das Konzert wurde durch die großzügige Unterstützung von Direktor Heinr. Seltmann ermöglicht. Am Nachmittag fand der Festzug statt, in dem sich die einzelnen Gruppen übertrafen. BM. Dr. Seebohm hielt die Festansprache und forderte die Rückgabe der Heimat. Mit dem Deutschlandlied fand diese Kundgebung ihren Abschluss. Nun sprach Lm. Maas zu den Landsleuten und stellte nochmals unser Recht auf das Egerland und das übrige Sudetenland heraus. Es erklang der 73er. Nun überreichte die Eghalanda Gmoi z Bayreuth BM Dr. Seebohm die Urkunde, die ihn zum Ehrenbürger der Grnoi und damit zu unserem Vetta ernennt. - Am Birnsunnta sollen 15000 Landsleute versammelt gewesen sein, ein Zeichen für die Volkstürnlichkeit und die Bedeutung dieser grenznahen Veranstaltung“.
Ergänzt wurde der Bericht durch ein Foto. „Birnsunnta in Schirnding“. Festwagen „Eiserner Vorhang“ (nach West Getreide und Früchte, hinterm Vorhang Dornen und Disteln).
Man sieht aus dem Bericht schon die neue Richtung des Festverlaufes, der mit Wendlingen in etwa identisch ist.
In der Chronik zum 50.Jubiläum der Gmoi Wendlingen steht zum
1.Vinzenzifest in Wendlingen:
.......Es war ja erst wenige Jahre her, dass aus allen Kirchensprengeln des Egerlandes die farbenprächtigen Trachtengruppen zum Vinzenzifest in die alte Reichsstadt Eger geeilt waren. Solche Erlebnisse vergißt man nicht. Mit großem Elan machte sich die Gmoi an die Verwirklichung. Als Zeitpunkt wurde der 30. und 31. August 1952 anberaumt. Was man in der Einladung schrieb, klang gleichzeitig unendlich traurig: „Wir richten an Euch die Bitte und Aufforderung: Egerländer, kommt nach Wendlingen am Neckar und erlebt an diesen Tagen, wenigstens einmal im Jahr, ein Stück Heimat.“
Am Samstagabend begann das Fest in der bunt geschmückten Turn- und Festhalle Unterboihingen. Umringt von den Fahnen des Egerlands mit einem großen Transparent das das Egerland zeigte, hing der Wahlspruch „Füa(r) unna Håimat åll's“. Auf der Bühne stand die Trachtengruppe des Bayernvereins Bavaria aus Kirchheim/Teck, die Dudelsackmusik der Egerländer Gmoi Stuttgart und die eigene Trachtentanzgruppe. Die Orchestervereinigung Wendlingen-Unterboihingen eröffnete den Abend mit dem Egerländer Marsch. Das eigentliche Programm bestritten dann die Dudelsackmusik aus Stuttgart, das Duett Helm-Rödl, die Schuhplattler vom Bayernverein und die eigene Tanzgruppe.
Der Festsonntag begann mit sechs Böllerschüssen um 6 Uhr morgens. Um 8 Uhr trafen die ersten auswärtigen Gäste ein, mit dem Frieden in der Festkanzlei in der Gaststätte Bären, dem Gmoilokal, war es nun vorbei. Ununterbrochen gaben sich die Vertreter der Gmoin und Vereine die Klinke in die Hand. Alle sammelten sich
um 10 Uhr bei der Unterboihinger St. Kolumbankirche. Als die Glocke 10.30 Uhr schlug, setzte sich eine feierliche Prozession in Bewegung, an der Spitze die Kleinsten, die Erntekrone schwebte über den Köpfen, gefolgt von vier Geistlichen. Dahinter der Zug der Trachtengruppen, anschließend die einheimische Bevölkerung. An einem viel bewunderten, eigens aufgebauten Altar, fand nun eine Pontifikalmesse statt. Gegen Ende der Messe verfinsterte sich der Himmel und ein Gewitter entlud sich.
Das Fest fiel aber nicht ins Wasser, mit halbstündiger Verspätung konnte der Festzug um 14 Uhr beginnen. Zwei Autos mit den Ehrengästen an der Spitze, gefolgt vom Musikverein Wendlingen, nahm der Zug seinen Weg von der Goethestraße zum Festplatz in Unterboihingen. Auf dem Festplatz konnte Festleiter Toni Rödl zunächst die Ehrengäste willkommen heißen: Landrat Dr.Schaude, Bürgermeister Kaiser und den Bundesvüarstäiha des Bundes der Egerländer Gmoin, Ernst Bartl. Nicht weniger herzlich wurden die teilnehmenden Vereine willkommen geheißen: Die Bayernvereine von Göppingen, Esslingen und Kirchheim/Teck sowie die Egerländer Gmoin von Stuttgart, Beuren, Kirchheim/Teck, Schwäbisch Gmünd, Kornwestheim und Plochingen. Landrat Dr. Schaude ergriff nun das Wort, hob die Verbundenheit zwischen Schwaben und Egerländern hervor und legte allen Anwesenden die gegenseitige Achtung der eigenen Traditionen ans Herz. Bürgermeister Kaiser begrüßte insbesondere die zahlreich erschienenen Altbürger und gab der Hoffnung Ausdruck, dass schon in wenigen Jahren nicht mehr zwischen Altbürgern und Neubürgern unterschieden werde, es vielmehr nur noch Bürger heißen werde. Es folgten verschiedene Darbietungen, anschließend konnten sich die Gäste auf dem großen Jahrmarkt am Festplatz ergehen.
Ab 20.30 Uhr spielten zwei Kapellen zum Tanz auf, Ernteschlußkränzchen wurde dies genannt.
In der Summe konnte man nach getaner Arbeit feststellen: Man hatte mutig begonnen, bis an die Grenzen der Anspannung gearbeitet, und man hatte Erfolg. Zwar ging noch manches schief und immer wieder mußte improvisiert werden, der Anfang aber war gemacht. Mancher Ehrengast ließ sich diesmal noch entschuldigen, viele Gmoin hatten andere Termine oder scheuten den Aufwand der Anreise angesichts der Ungewißheit, was da nun in Wendlingen am Neckar tatsächlich zusammenkam.
Hier jetzt die wichtigsten Unterschiede zu „vor dem Krieg“:
Statt der im Egerer Land gelegenen Kirchspiele Albenreut, Treunitz, Lohma, Trebendorf, Nebanitz, Mühlessen, Frauenreut und Mühlbach kommen jetzt die Egerländer Gmoin aus Baden-Württemberg und dem angrenzenden Bayern, Abordnungen der Banater Schwaben, Siebenbürger Sachsen, Schlesier, Schönhengstgauer und andere Vertriebenen-Landsmannschaften und nicht zuletzt die den Egerländern verbundenen bodenständigen Heimat- und Trachtenvereine, die örtlichen Vereine und heute selbstverständlich, die Bevölkerung aus Wendlingen und Umgebung.
Das Fest ist nicht mehr nur auf den Sonntag beschränkt, sondern beginnt bereits am Freitag und dauert bis Montag. Für die Predigt stellte sich so gut wie immer ein hochrangiger Geistlicher Herr zur Verfügung. Die Vorbereitung der Pontifikalmesse lag von Anfang an in den Händen des jeweiligen Unterboihinger Pfarrers, die sich alle sehr um die Sache bemühten und ohne deren Einsatz nd Hilfe das Fest vom Anfang an zum Scheitern verurteilt gewesen wäre. Dazu kommt am Sonntag nach dem Gottesdienst die Ansprache eines Politikers, meistens einem Mitglied der Landes - oder Bundesregierung, entweder der Schirmherr des Festes selbst, oder sein Vertreter. Auch Vertreter aus Bonn oder z.B. der tschechische Botschafter waren die Festredner; die Auswahl geht quer durch alle Parteien.
(Deshalb muß die von einem Herrn Habl an der Uni Bayreuth angefertigte Studienarbeit über das „Fest“ nach der Vertreibung, größtenteils als falsch bezeichnet werden. Dort wird die These aufgestellt, dass das Fest politisch rechtslastig sei, von uniformierten Teilnehmern ist die Rede (gemeint ist die Tracht) und ähnliche unhaltbare Theorien werden entwickelt. Die Arbeit zielt ganz in die Richtung, die man auch von einem großen Teil der Presse gewöhnt ist, der Versuch die Vertriebenen immer wieder in die rechte Ecke zu stellen. Dies war besonders zur Zeit, als Minister Dr. Seebohm ständiger Gast beim Vinzenzifest war, immer wieder der Fall. Leider wurde weder von Seiten unseres Bundesvorstandes noch des Landesvorstandes etwas dagegen unternommen, obwohl entsprechende Hinweise auf die Arbeit erfolgt sind. Doppelt traurig ist diese Angelegenheit, da die Grundlagen für die Studienarbeit mehr oder weniger von der Egerland-Bücherei geliefert wurden und die damalige Leiterin des Egerlandmuseums, als Betreuerin noch Schützenhilfe leistete).
Parallel zum „Fest“ läuft ein umfangreiches Kulturprogramm, mit Ausstellungen, Konzerten, Festvorträgen namhafter Autoren. Wichtig war am Anfang und zu einem gewissen Grad auch heute noch, das „Wiedersehen-Treffen“ der Teilnehmer, die oftmals von weit her kamen um Freunde und Nachbarn von Daheim zu treffen und mit ihnen für ein paar Stunden im gemeinsamen Gespräch, die Gegenwart zu vergessen und Mut für die Zukunft zu schöpfen. Manches Schicksal verschollener Landsleute wurde dabei geklärt.
Seit den 90iger Jahren war das Fest ein vielversprechender Anfang einer Verständigung mit den Nachkommen unserer Vertreiber; leider blieb es mehr oder weniger ein Versuch, der in seinen Anfängen stecken blieb, -es ist nicht unsere Schuld.
Im Folgenden werden einige wichtige Daten der „Feste“ nach 1945 festgehalten
1. Vinzenzifest in Eger am 6. Dezember 1693:
18. Oktober 1693, Reliquie von Wien nach Eger überführt, Beisetzung in der Rathauskapelle, 6. Dezember1693, am Gedenktag des Patronatsheiligen St. Niklas, feierliche Überführung in die Stadtkirche.
1. Vinzenzifest nach der Vertreibung:
28.8.1949 in Schirnding, = 256 Vinzenzifest
31.8.1952 in Wendlingen a.N. = 259 Vinzenzifest
2. Vinzenzifest, 30. August 1953:
Die Egerl.Gmoi und damit die Stadt Wendlingen erhält auf Betreiben von Landrat Dr.Schaude die Genehmigung zur Abhaltung eines sonntäglichen Vinzenzimarktes und damit das Marktrecht, befristet auf 5 Jahre.
3. Vinzenzifest, 30. August 1954:
Widerstand gegen den Markt am Sonntag regte sich in einem Teil der Bevölkerung, auch von Seiten des Evangelischen Pfarrers von Wendlingen, Ernst Fischle. Der Unterboihinger Pfarrer Hug ergriff in seiner Predigt vor 2500 Gläubigen am Sonntag, Partei für die Egerländer und den Markt am Sonntag; er nannte die Kritiker „Kleingeister“, die sich vor dem Wert anderer Traditionen Verschließen würden, das sei keine christliche Gesinnung, sondern ein Armutszeugnis. Die Befristung wurde aufgehoben, der Markt blieb den Wendlingern bis heute erhalten und ist nach 50 Jahren größer denn je!
4. Vinzenzifest, 30. August 1955:
Es wurde das Jahr des eigentlichen Durchbruchs des Vinzenzifestes und setzte in vielerlei Hinsicht neue Akzente, trotz der Tatsache, dass einheimische Vereine, wie etwa der Musikverein Wendlingen, demonstrativ absagten.
Erstmals begann man bereits am Samstagnachmittag, erstmals ist eine Ausstellung mit sehr hohem Niveau Bestandteil des Festes. Otto Zerlik und Medizinalrat Dr.Hochsieder eröffnen in der Behrkantine die Ausstellung "Sudetendeutsche Weltbäder". Die musikalische Umrahmung hatte die Orchestervereinigung Wendlingen-Unterboihingen übernommen mit der der Symphonie in G-Dur von Christopf Willibald Gluck und dem Kaiserquartett von Joseph Haydn.
Zwei Besonderheiten verliehen dem Festgottesdienst am Sonntag einen eindrucksvollen Rang: Zum einen war das die Festpredigt von Prof. Dr. Prokop, Abt von KlosterRohr (früher Braunau /Sudetenland), dem es gelang, in gänzlich freier Rede die Kultur des Egerlandes in Kernsätzen zusammenzufassen. Ein Egerländer verlöre seine Heimat nie ganz, weil er seine eigentliche Heimat in sich habe. Ihre ganze Kultur wurzele in einer entschiedenen christlichen Grundhaltung, die jedem Egerländer eigen ist.
Zweitens war es die Tatsache, wie ein aufmerksamer Beobachter feststellte, dass bei der gemeinsam gesungenen Deutsche Messe von Schubert, zum Erstaunen der Einheimischen, die Egerländer kein Textblatt benötigten.
Am Festzug nahmen neben anderen Ehrengästen der Landrat Dr.Schaude, BM Kaiser und Bvst. Ernst Bartl teil, gefolgt von 400 Trachtenträgern, davon 120 Egerländer.
5. Vinzenzifest, 30. August 1956:
Mit Bundesminister Dr. Hans Christoph Seebohm konnte man erstmals einen hochkarätigen Gast aus den Bonner Regierungskreisen begrüßen. Der Minister reihte sich, von der Autobahneröffnung in Baden Baden kommend, spontan in den Festzug ein.
In seiner Rede im Festzelt, dachte er an die vergangenen Hungerjahre und dankte er für die Ernte. Die Egerländer hätten sich zwar eine neue Heimat geschaffen, aber Trost spende die Bibel. Er erinnerte an die Söhne Israels die aus der Heimat vertrieben, erst nach sieben Jahrzehnten hätten dorthin zurückkehren können. Gottes Zeit könne eben lange wären aber Gerechtigkeit werde einst auch den Egerländern widerfahren und dann würden die Glocken von St.Niklas zu Eger auch ihnen wieder wie einst zum Erntedankfest läuten.
10. Vinzenzifest, 30. August 1961:
Das 10.Vinzenzifest war „der“ Höhepunkt! Pontifikalmesse und Predigt hielt Abt Petrus Möhler, em. Abt des Stiftes Tepl, ehemals der ranghöchste Geistliche des Egerlands, begleitet von Pfarrer Niedermaier Wendlingen.
Hauptredner war Dr.Josef Stingl (Maria Kulm), der seine Rede zum größten Teil in Mundart hielt.
Die neue Gmoifahne wurde geweiht; Fahnenpatin ist Mouhm Rosa Rödl und die Ausstellung „Alt Eger“ wurde gezeigt.
Ehrengäste waren der Stv.BM. der Stadt Wendlingen am Neckar, Dipl.-Ing. Walter Aldinger (Für den erkrankten BMKaiser), Landrat Dr.Schaude, MdB Ernst Paul (SPD), MdB Thomas Ruf (CDU) und Staatssekretär Sepp Schwarz von der Landesregierung. Vom BdeG. kam Vorstandsmitglied Vetter Hans Ströher mit seiner Mouhm Mizzi, Landesvüarstäiha Hessen, Vetter Fiebiger, Bundesümgöldner Vetter und Mouhm Mädler, und der Leiter der Studienbücherei, Vetter Std.Prof.Lois Eisner.
Der eigentliche Höhepunkt aber war am Montag; - Ein fünfstündiges Konzert mit dem damals schon legendären Egerländer Ernst Mosch und seinen original Egerländer Musikanten. Als Dr.Schaude den Egerländer Marsch dirigierte, war das Festzelt mit mehr als dreitausend Menschen brechend voll und polizeilich gesperrt, es verlief alles aber ganz normal. Doch als dann die Musiker für den Landesvorsteher Toni Rödl das Egerländer-Lied: "Ei Tone, ei Tone", intonierte, singt alles ausgelassen mit, das Lied wird zum Schlager das Tages.
Es wurden über 30 000 Besucher gezählt, ein Ausbau des Vinzenzifestes schien kaum mehr möglich.
Die folgenden Feste hatten zwar auch ihre Höhepunkte, sei es eine besondere Ausstellung, ein prominenter Geistlicher als Prediger für die Messe und ein ebenso prominenter Gastredner für die Patenschaftsrat-Sitzung, usw., einige sind aber doch ausführlicher zu erwähnen, da sie zur weiteren Konsolidierung des Festes beitrugen.
Es war das 15. Vinzenzifest mit der Patenschaftsübernahme, das 19. Vinzenzifest mit der Eröffnung der Egerländer Heimatstube, das 24. Vinzenzifest mit „10 Jahre lebendige Patenschaft“, das 25. Fest mit der Einweihung der Vinzenzikapelle und das 30.Vinzenzifest mit der Einholung der Reliquie. Das 31. Vinzenzifest mit „Grundsätze der Patenschaft“, das 36.Vinzenzifest mit „300 Jahre Balthasar Neumann“, das 37. Vinzenzifest stand im Zeichen des Egerländer Musikantenbrunnes. Das 41. und 42. Vinzenzifest sind erwähnenswert, da die Kopfreliquie in Eger im Mittelpunkt stand. Mit dem 50. und 51. Vinzenzifest gelang es den Egerländern durch das Fernsehen und eine Ausstellung im Kaufhaus Karstadt, die Egerländer, das Vinzenzifest und nicht zuletzt, die Stadt Wendlingen am Neckar einem breiten Publikum näher zu bringen.
15. Vinzenzifest, 30. August 1966:
In seltener Einmütigkeit beschloss der Gemeinderat der Stadt am Neckar am 11. November 1965 einstimmig, die Patenschaft über die Egerländer des Landes Baden Württemberg zu übernehmen.
In einem Schriftsatz vom 20. September 1965 wandte sich Rödl, selbst Stadtrat, an den Gemeinderat der Stadt. Die Egerländer hätten mit der neu geschaffenen Tradition des Vinzenzifestes der Stadt an Neckar und Lauter eine große Ehre erwiesen, Wendlingen am Neckar sei weit über die Grenzen des Landes hinaus bekannt geworden. Es sei der Wunsch der Egerländer in Wendlingen am Neckar eine besondere Heimatstadt zu erhalten. Der Gemeinderat wusste, was die Stadt den Egerländern verdankte, so kam es zu der einstimmigen Annahme des Antrages.
Den besonderen Rahmen für die Patenschaftsfeier bot das 15. Vinzenzifest 1966. Alle maßgeblichen Freunde der Egerländer waren zugegen: Erneut Bundesminister Dr. Seebohm, der Nürtinger Landrat
Dr. Schaude, der Göppinger Oberbürgermeister Dr. König sowie Staatssekretär Sepp Schwarz, Bundesvüastäiha Ernst Bartl. Toni Rödl, der die Patenschaftsurkunde aus der Hand von Bürgermeister Kaiser entgegennahm, ließ sich auch vor einem so erlauchten Publikum die launige Rede nicht nehmen. Patenschaft, sagte er bedeute Obhut für einen Schwächeren. Nun hätten sich die dickschädligen Egerländer zwar noch nie schwach gefühlt, aber nach 1945 hätten sie doch Hilfe gebraucht. In Wendlingen am Neckar hätten sie Heimatbewusste Gesinnungsfreunde gefunden, die ihnen den Wiederaufstieg aus Verzweiflung und Elend ermöglichten.
19. Vinzenzifest, 31. August 1970:
Als am Samstag, den 30. August 1969 zum ersten mal der Patenschaftsrat zusammentrat, stellte Bürgermeister Kaiser fest, dass alle Punkte, die bei der Patenschaftsübernahme 1966 aufgestellt wurden, bis auf einen in die Tat umgesetzt wurden, die Errichtung der Egerländer Heimatstube. Er verkündete dann einen einstimmigen Beschluss des Gemeinderates, dass nunmehr im alten Schul- und Rathaus in Unterboihingen ein Klassenzimmer für die Egerländer zur Verfügung steht. Es begann in der Folge davon eine Aktivität bei den Egerländern nicht nur in Wendlingen, der ganze Landesverband war daran beteiligt, allen voran der Rödl Toni, auf dem die Hauptlast der Arbeit lag. Pünktlich zum 19. Vinzenzifest war alles fertig. Bürgermeister Kaiser konnte die Heimatstube eröffnen und den Schlüssel offiziell an Toni Rödl übergeben. Ein lange gehegter Wunsch der Egerländer ging in Erfüllung. Fast 30 Jahre lang war die Heimatstube, die mit der Zeit über immer mehr Exponate verfügte, im Alten-Schulhaus untergebracht. Im barocken Unterboihinger Alten Pfarrhaus wird nun die Egerländer Heimatstube, wie 1982 der Gemeinderat der Stadt in den „Grundsätzen für die Patenschaft….“ beschloss, Teil des Stadtmuseums sein und bleiben.
24. Vinzenzifest, 30. August 1975:
1975 bestand die Patenschaft der Stadt Wendlingen am Neckar über die Egerländer in Baden-Württemberg zehn Jahre. Zu diesem Anlass fand ein Festakt in der Aula des Robert-Bosch-Gymnasiums statt. Gastredner war der Oberbürgermeister von Göppingen, Dr.König, der zur Zeit der Gründung des Vinzenzifestes Regierungsrat im Nürtinger Landratsamt war und durch dessen besonderen Einsatz es gelang, dass das Marktrecht zum Vinzenzifest nach Wendlingen kam. In seiner Rede, die unter dem Mottostand: Patenschaften sind die Brücken von Heimat zu Heimat, warnte er als einer ernsthaften Gefahr davor, die Heimat nicht ernst zu nehmen; heimatlose Menschen laufen Gefahr Treibgut der Geschichte zu werden. Im Rathaus wurde zumGedenken der Patenschaftsübernahme der Stadt Wendlingen am Neckar über die Egerländer in Baden-Württemberg eine Gedenktafel enthüllt.
25. Vinzenzifest, 29. August 1976:
Höhepunkt des 25. Festes war der neu geschaffenen Vinzenzikapelle in St.Kolumban in Unterboihingen. Die Einweihungszeremonie erfolgte durch Pfarrer Niedermaier und Geistl.Rat Monsignore Pater Jordan Fenzl.
Die Egerländer Gmoi z´Wendllingen stellte die Mittel zur Verfügung, die Seitenkapelle in St. Kolumban zur „Vinzenzikapelle“ auszubauen. Der Karlsbader Bildhauer Wilhelm Hager schuf die nötigen Voraussetzungen dazu. Es war das Tabernakel zur Aufnahme der erwarteten Reliquie bzw. des Reliquiars, die kunstvollen Seitenfenster und die übrige Ausstattung für einen Andachtsraum.
30. Vinzenzifest, 30. August 1981:
Mittelpunkt des 30. festes war die feierliche Einholung der Reliquie nach Wendlingen und Einbringung in die Vinzenzikapelle von St. Kolumban in Wendlingen-Unterboihingen.
Schon von Anfang an war es der Wunsch der Egerländer allen voran Toni Rödl, in Wendlingen am Neckar eine Reliquie des Hl. Vinzenzi zu haben. Beim 30. Vinzenzifest 1981 ging dieser Wunsch in Erfüllung. Toni Rödl wusste von den guten Beziehungen von Prälat Dr. Karl Reiß, ein häufiger Gast beim Vinzenzifest, zu Kardinal König in Wien. So richtete er an ihn die Bitte, in Sachen Reliquie tätig zu werden. Auf Betreiben von Prälat Dr. Karl Reiß, der den Kontakt zu Kardinal König in Wien herstellte, war es dank der Unterstützung des Wiener Kardinals gelungen, dass der Augustiner Pater Bernhard Tonko in Wien einen Teil der dort aufbewahrten Reliquie des hl. Vinzenzi zu entnehmen und nach Wendlingen überführen durfte. Sie wurde dort, gefasst in einem Reliquiar, das Prälat Dr. Reiß von einem Goldschmied in Kevelaar hatte anfertigen lassen, von seinem Mitbruder Geistl.Rat Monsignore Pater Jordan Fenzl in Empfang genommen und in einer feierlichen Einholung in die Vinzenzikapelle von St. Kolumban in Unterboihingen verbracht.
Erstmals wurde die Reliquie am Sonntag, den 30. August 1981, bei der Erntedankprozession mitgetragen und die zahlreichen Teilnehmer des Gottesdienstes damit gesegnet.
31. Vinzenzifest, 30. August 1982:
1982 hat der Gemeinderat einstimmig einem von Bürgermeister Köhler verfassten Papier zugestimmt:
„Grundsätze für die Patenschaft der Stadt Wendlingen am Neckar für die Heimatgruppe der in Baden-Württemberg beheimateten Egerländer“.
In diesem Gemeinderatsbeschluss werden zu den Punkten der Patenschaftsübernahme vom 27.8.1966, exakte Ausführungsbestimmungen beschrieben. Die einzelnen Punkte sind:
I. Träger der Patenschaft; II. Inhalt der Patenschaft; 1. Allgemeine Patenschaftspflege; 2. Kulturelle Patenschaftspflege; 3. Patenschaftspflege im Bereich der Jugend- und Erwachsenenbildung; 4. Patenschaftspflege durch Öffentlichkeitsarbeit; 5. Sonstige Aufgaben der Patenschaft; III. Patenschaftsrat.
Dieses Papier wurde beim 31. Vinzenzifest der Öffentlichkeit vorgestellt. Ein ganz wichtiger Punkt steht unter 5. wo festgelegt wird, dass die Egerländer Heimatstube ein Teil des Heimatmuseums sein und bleiben soll, auch wenn die Egerländer Heimatgruppe selbst nicht mehr in der Lage ist, für die Verwaltung zu sorgen, aus welchen Gründen auch immer.
36. Vinzenzifest, 30. August 1987:
Das 36. Vinzenzifest 1987 war ein Höhepunkt, der die Stadt Wendlingen am Neckar international bekannt machte. Der 300. Geburtstag des gebürtigen Egerländers, der mit seiner Heimatstadt Eger ein Leben lang verbunden war, Balthasar Neumann, war der Anlass dazu. Man widmete ihm eine Ausstellung und brachte dazu einen weltweit beachteten Katalog heraus. Es war gelungen, die Ausstellung überwiegend mit Originalen zu gestalten und das von einem der größten Barockbaumeister. In den Händen von Prof.Dr. Erich Hubala, Würzburg, lagen Planung und Ausführung der Ausstellung. Seine rechte Hand dabei war Waltraud Lenhart MA., ein aktives Mitglied der Wendlinger Gmoi seit ihrer Kindheit, das sie bei der Ausstellungseröffnung zeigte, als sie bis auf´s „Schnurrntoichl“ original, in ihrer „Echarischn Tracht“ erschien. Mit dieser Ausstellung erreichten die Egerländer und damit ihre Patenstadt Wendlingen am Neckar ein bundesweites Medienecho.
37. Vinzenzifest, 30. August 1988:
Einen Markstein setzte das 37.Vinzenzifest 1988, an dem der Egerländer Musikantenbrunnen in der Neuen Stadtmitte von Wendlingen am Neckar eingeweiht werden konnte. In der alte Reichstatt Eger standen 3 Brunnen im Mittelpunkt der Stadt, der bekannteste davon war der „Wåstl“, eine wehrhafte Rolandsfigur, die auch in anderen Reichsstädten zu finden ist. Der neue Brunnen soll das ganze Egerland sichtbar machen durch die 15 Wappen der bedeutendsten Egerländer Städte rund um den Brunnen. Im Mittelpunkt aber stehen hervorgehoben, einträchtig nebeneinander,
die Wappen von Eger und Wendlingen. Die Brunnenfiguren sind nichts „Wehrhaftes“, sondern friedliche Musikanten, „Geign, Dudlsook, Kla(r)nen und der Båß“. Diese Träger der Egerländer Volksmusik schlecht hin, wurden geschaffen von dem aus Espenthor bei Karlsbad, heute in Essingen bei Aalen wirkenden Kunstschmied. Er zeichnet nicht nur für die Ausführung verantwortlich, sondern auch für den künstlerischen Entwurf, der sein Beitrag für die Verwirklichung des schon lange geplanten Brunnens war. Die 80 000 Mark teuere Anlage wurde in der Hauptsache durch Spenden der Egerländer, der Wendlinger Bevölkerung und nicht zuletzt durch die Stadt Wendlingen am Neckar finanziert.
41. Vinzenzifest, 30. August 1992:
Die Kopfreliquie aus Eger ist zu Gast bei der Prozession in Wendlingen am Neckar; ermöglicht hat dies der stelv.Bürgermeister von „Cheb“ und stellv. Landesvorsitzender der Sozialdemokratischen Partei, Petr Moravek, der die obersten Kirchenherren in Prag zu dieser zweitägigen Leihgabe bewegen konnte.
Das Reliquiar wurde, wie dereinst in Eger, von 2 Ministranten in der Prozession getragen. Danach konnte
sie in der Egerländer Heimatstube im Alten Schulhaus, besichtigt werden und zog einen großen Besucherstrom an.
Vermerkt sei noch, dass das Fest diesmal auf dem neuen Festplatz am Schäferhauser See stattfand.
42. Vinzenzifest, 29. August 1993:
Das 42. Fest, stand ganz im Zeichen des Gedenkens an das 1. Vinzenzifest vor 300 Jahren, als die Reliquie des Hl. Vinzenzi von Rom über Wien nach Eger überführt wurde, um in der St. Niklas-Kirche einen Platz zu finden.
1993 bekam die Patenstadt mit Andreas Hesky einen neuen Bürgermeister und der Patenschaftsrat einen neuen Vorsitzenden.
50. Vinzenzifest, 29. August 2001:
Das 50. Vinzenzifest war in jeder Hinsicht ein Höhepunkt. Das Fernsehen berichtete in einer dreiviertelstündigen Sendung darüber. Ein Experte urteilte so: die Egerländer haben einen Pflock eingeschlagen, der die nächsten 50 Jahre Bestand hat.
Das Wetter spielte mit, sodass die vom Wendlinger Gmoivüarstäha Horst Rödl geplante Logistik Dank seiner Helfer bis ins kleinste Detail umgesetzt werden konnte.
Viele Ehrengäste konnte Landesvüarstäiha Albert Reich bei der Eröffnung begrüßen so: von der Landesregierung Staatssekretär Heribert Rech, MdL Landesbeauftragter für Vertriebene, SL-Bundesvorsitzender Bernd Posselt, MdEP, Mitglieder des Regionalparlaments und des Gemeinderates, Geistl.Rat Monsignore Pater Jordan Fenzl, Monsignore Prof. Maluš Prag-Budweis, Stadtpfarrer Paul Magino, Jean Thuollot von der Partnerstadt Saint-Leula-Foret, Bürgermeister Josef Pleikerer aus der Partnerstadt Millstatt/Österreich, Primator Václav Jakl aus Cheb/Eger, mit Abordnung sowie dem Jugendblasorchester und den Majoretten, Vertreter der Landsmannschaften und der Trachtenverbände dabei der Bundesvorsitzende des Deutschen Trachtenverbandes, Günther Putz aus Darmstadt, Richard Šulko, Pilsen vom BdD-LE und vom BdEG der Bundevüarstäiha Günther Müller, LV Josef Zuleger, Salzburg sowie viele Gmoivüarstäiha mit Begleitung.
Der Patenschaftsratvorsitzende Bürgermeister Andreas Hesky ließ in seiner Ansprache die letzten 50 Jahre Vinzenzifest Revue passieren und gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass zur Aufnahme der Tschechischen Republik die Beneš-Dekrete keinen Platz in einem fest gefügten Haus Europa hätten, Ziel müsse es sein gemeinsam offen und ehrlich die Geschichte aufzuarbeiten.
Oberbürgermeister Václav Jakl aus Cheb/Eger betonte in seiner auf Deutsch gehaltenen Ansprache erneut die Bereitschaft zu der von Bürgermeister Hesky geforderten gemeinsamen Aufarbeitung der Vergangenheit.
Weitere Grußworte sprachen der Vorsitzende des Deutschen Trachtenverbandes, Günther Putz, der Vorsitzende des Südwestdeutschen Gauverbandes der Heimat- und Trachtenvereine, Gunther Dlabal, Vom BdEG Bundevüarstäiha Günther Müller und vom Partnerschaftskomitee der französischen Partnerstadt Saint-Leu-la-Forêt, Jean Thuollot.
Der Festsonntag begann wie immer mit der Prozession. Im Anschluss an die Prozession, diesmal mit sehr viel Teilnehmern, zelebrierte die Pontifikalmesse seine Exzellenz Bischof von Rottenburg-Stuttgart Dr.Gebhard Fürst, mit Unterstützung durch Monsignore Prof. Maluš Prag-Budweis, Geistl.Rat Monsignore Pater Jordan Fenzl und natürlich der Herr über St. Kolumban HH.Pfarrer Paul Magino.
Danach war ein offenes Tanzen am Rathausplatz mit vielen Trachtengruppen und im Sitzungssaal des Rathauses fand der Empfang der Stadt Wendlingen am Neckar mit zahlreicher Prominenz und Ansprachen statt.
Am Nachmittag folgte wie immer der Festzug, er war aber nicht wie immer, sondern sehr viel länger, er dauerte diesmal Stunden und wurde vom Fernsehen übertragen.
Der Südwest-Rundfunk begleitete das Festgeschehen am Wochenende mit mehreren Fernsehteams. Ausgestrahlt wurde die Sendung am Sonntag im SWR 3 „Treffpunkt“, einer Sendereihe unter der Leitung von Gerd Motzkus. Bereits am Donnerstag und Freitag war die verantwortliche Redakteurin Doris Buhlinger mit einem Team in Wendlingen vor Ort, um das Rahmenprogramm aufzunehmen.
Dem Leiter der Sendung Gerd Motzkus und seiner Redakteurin Doris Buhlinger herzlichen Dank für die hervorragende in allen Teilen objektive Berichterstattung.
Am Rand sei noch vermerkt, dass bei der Aufnahme des Gesprächs von Gerd Motzkus mit Mouhm Brigitte Storm über die Eghalanda Buchtln einige Anläufe (wegen störender Nebengeräusche) nötig waren, bis der Bericht im Kasten war; jede neue Klappe war für Gerd Motzkus mit dem Verzehr einer neuen Buchtel verbunden. Es war aber vorgesorgt, Mouhm Storm hatte 50 Buchteln mitgebracht, die aber am Ende des Interviews verschwunden waren, sie hatten nicht nur dem Chef, sondern anscheinend auch seiner Mannschaft geschmeckt.
51. Vinzenzifest, 29. August 2002:
Das Fest war eingebunden in das Deutschen Trachtenfest 2002 und wurde gemeinsam mit diesem gefeiert, - oder umgekehrt? Der Festverlauf war nämlich im großen Ganzen wie immer, nur viel größer und bunter. Es kamen Trachtengruppen aus allen Teilen Deutschlands und dem angrenzenden Ausland, Frankreich, Holland, Österreich, Georgien, Freoul, Polen usw.
Die Prozession war riesig und, so paradox es klingt, der anschließende Gottesdienst war ein Ökumenischer, gefeiert von Pfarrer Magino und seinem evangelischen Kollegen Pfarrer Bofinger. Der Höhepunkt war der, vom Fernsehen übertragene, Festzug, angeführt von den Maskottchen Baden-Württembergs, Greif und Hirsch, sowie der Vom Ministerpräsidenten Erwin Teufel an den Bürgermeister Andreas Hesky für die Stadt Wendlingen am Neckar verliehene „50 Jahre Baden-Württemberg-Fahne“. Stunden dauerte es diesmal, bis die letzte Gruppe an der Ehrentribüne mit dem Schirmherrn, Ministerpräsident Erwin Teufel verübergezogen war und ihm Referenz erwiesen hatte. Mit einigen fest platzierten Kameras und mehreren Teams, die den Festzug begleiteten, wurde das Material für die Sonntagabend Sendung „Treffpunkt“ aufgenommen. Die Leitung hatte Gerd Motzkus und Die Moderatoren waren Sonja Schrecklein und als Comoderatoren die Trachtenexperten Wulf Wager und Jürgen Hohl.
Auch der Vinzenzimarkt war diesmal noch viel reichhaltiger, ihm war ein Trachtenmarkt angeschlossen, wo Trachtenstoffe, Zubehör, Fachbücher und vieles mehr für die „Trachtler“ feilgeboten wurde.
Das Fest war durch die exakte Planung der Stadtverwaltung, allen voran die Herren Laderer, Vöhringer und Thieme und dem Logistik-Spezialisten Horst Rödl, dem Vüarstäiha der Gmoi z´Wendlingen mit seinen Helfern, ein voller Erfolg, trotz aller Unkenrufe, das Fest sei für Wendlingen einige Nummern zu groß.
Die Egerländer hatten die Möglichkeit, sich im Rahmenprogramm des Deutschen Trachtenfestes in einer Ausstellung im Kaufhaus Karstadt-Stuttgart zu präsentierten; vorweg, die dreiwöchige Ausstellung war ein voller Erfolg.
Die Ausstellung hatte zum Thema: „die Egerländer, Reflexionen aus Kunst, Kultur und Tradition“.
Geplant und ausgeführt wurde die Ausstellung von der Karstadt-Werbeabteilung, ihrem Chef, Herrn Dietmann und Herrn Wiesener, von der Egerländer Heimatstube die Vettern Storm und Rödl, sowie der Landestrachtenwartin Mouhm Hlawatsch.
Zur Verfügung standen 4 große Schaufenster mit Blick zur Königstrasse, die wir gemeinsam mit dem Südwestdeutschen Gauverband der Heimat und Trachtenvereine gestalteten, wobei eine Auslage nur Egerland war. Im Kaufhaus standen zu beiden Seiten der Rolltreppenaufgänge Vitrinen und Schautafeln und das über alle 3 Stockwerke. In der 1. Etage lief pausenlos auf einem Großbildschirm der Film des SWR über das 50.Vinzenzifest von Gerd Motzkus. Wer das Karstadt kennt weiß, dass dort täglich Tausende an den Schaufenstern vorbeigehen und nicht viel weniger die Innenräume besuchen. Wir haben also als Egerländer ein breites Publikum angesprochen, nicht zuletzt aber auch Werbung für unsere Patenstadt Wendlingen am Neckar gemacht.
Oskar Storm, Neuhausen / Filder, Mai 2000, überarbeitet März/April 2003, ergänzt August 2004.
Quellen:
Heribert Sturm: „Eger Geschichte einer Reichsstadt“, Bd. I S. 301/302; Bd.II S. 342/343, S.354
Artur Zechel: „Feste und Feiern “; „Eger und das Egerland, Bd.II, Volkskunst und Brauchtum“, (Hrsg. Lorenz Schreiner) Seite 439 ff
Georg R.Schroubek:„Volksfrommes Wallfahrten in Eger und seinem Umland“, „Eger und das Egerland, Bd.II, Volkskunst und Brauchtum“, (Hrsg. Lorenz Schreiner) Seite 460 ff .
Heinrich Kraus: „Das Jesuitentheater in Eger“, „Eger und das Egerland, Bd.II, Volkskunst und Brauchtum“, (Hrsg. Lorenz Schreiner), Seite 560
Johann Miller, SJ: "Egra sancta, das ist Kurtzer Bericht von denen heiligen Reliquien, welche in der Stadt Eger aufbewahrt werden", gedruckt bei Nikolaus Dextors Witwe in Eger 1694. deutsche Übersetzung aus „Egra sancta“ in dem Aufsatz: „Zur Erinnerung an die erste Sct.Vinzenzi-Prozession vor 210 Jahren (am 6. Dez. 1693)“, in EJ = Egerer Jahrbuch 34 (1904), S. 235-238; abgedruckt auch bei Sturm, a.a.O., Bd. II, S. 342
Heinrich Gradl: „Deutsche Volksaufführungen., Nr. 91, nach der handschriftlichen Chronik von Salomon Gruber im Egerer Stadtarchiv“.
a. O. Nr. 11 (1895): Das Bittgesuch des Magistrats nach Regensburg
Vinzenz Prökl: „Geschichte der Stadt Eger und des Egerlandes“ 2.Aufl. (1877), Bd.II, S 239 f.;
J. W. Goethe: „Briefwechsel und mündlicher Verkehr zwischen Goethe und dem Rathe Grüner“. Leipzig 1853;
Adolf Hauffen: „Goethe und der Egerer Magistratsrat Grüner“, in: Deutsche Arbeit Nr.1 (1901/02),
S. 31 ff. darin (S. 33) die Stelle aus „Tagebücher“; Nr.8, S. 96-98 .
Hans Nikolaus Krauß: Roman "Die Heimat", Bd.III, "Die Stadt" (1902)
Gerhard Hergenröder: „Von der Eger an den Neckar“, Chronik der Egerl.Gmoi Wendlingen am Neckar 1999.
„Egerer Zeitung“: Jahrgang 49, Nr.8, August 1998. Birnsunnta - Vinzenzifest - Erntedank
„Unser Egerland“: 10.Jg. (1906) Heft 12; 11.Jg. (1907), Heft 13; 25.Jg. (1921), Heft 2, Seite 8.
„Der Egerländer- Eghalanda Bundeszeiting“: 1. Jg.1950, Flg. 2; 3. Jg.1952 Flg. 10, Jg. 2001, Flg.10, Jg2002, Flg. 9;10..